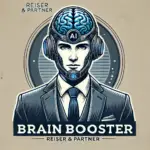In Zeiten geopolitischer Krisen und kriegerischer Auseinandersetzungen stellt die Mobilisierung aller wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ressourcen eine zentrale Herausforderung dar. Die Kriegswirtschaftsverordnung (KWVO) von 1939 wurde in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs eingeführt, um die Wirtschaft vollständig auf die Bedürfnisse der Kriegsführung auszurichten.
Mit strikten Vorgaben zu Produktion, Ressourcenlenkung, Preisen und Arbeitskräften griff die Verordnung tief in das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben ein und schuf die Grundlage für eine zentral gesteuerte Kriegswirtschaft.
Da es wohl als ausgemachte Sache gelten kann, dass heute 2025 niemand, nicht mal die erfahrensten Unternehmenslenker, abschätzen können, welche Folgen eine Umstellung auf Kriegswirtschaft 2025 bedeuten würde, haben wir uns bei Reiser & Partner die Mühe gemacht zu diesem Thema zu recherchieren, und uns zu fragen wie im Jahr 2025 eine – neue Kriegswirtschaftsverordnung aussehen könnte und welche Folgen sie haben könnte. Natürlich hoffen auch wir das es nicht zu diesen Schritten kommt, aber Unternehmenssicherheit ist auch mit diesem Thema eng verknüpft. Eine weise Sicherheitsplanung und der betriebliche Krisen- und Katastrophenschutz müssen sich daher auch mit diesen Themen (realistisch) auseinandersetzen.
In der heutigen Welt des Jahres 2025 würde eine ähnliche Kriegswirtschafts Verordnung weit komplexer und schädlicher für die Bevölkerung ausfallen – als zu Zeiten von 1939. Es empfiehlt sich daher nicht davon auszugehen, das eine moderne Volkswirtschaft von 2025 einfacher oder leichter die Folgen einer Kriegswirtschaftseinführung verkraften würde. Mitnichten. Eine moderne digitale und auf hochkomplexe Produkte ausgestattete Volkswirtschaft: Fällt tiefer, Leidet mehr und benötigt nach Einstellung eines Konfliktes eine deutlich längere ‚Wiederaufbauzeit‘ um das gleiche technologische Ausgangsniveau zu erreichen als die deutsche Nachkriegswirtschaft nach 1945. Ein Komplexitätsniveau und Vernetzungsgrad wie 2025 erreicht kein Land der Erde alleine und über Nacht. Wir sehen uns die Auswirkungen später genauer an.
In jedem falle kann festgehalten werden, dass die technologische Entwicklung, globalisierte Lieferketten und die digitale Transformation, die Anforderungen an staatliche Eingriffe in Krisenzeiten stark verändert haben.
Beginnen wir: Kriegswirtschaftsverordnung von 1939
Dieser Text analysiert zunächst die vollständige historische Kriegswirtschaftsverordnung von 1939, entwickelt eine spekulative, moderne Fassung für das Jahr 2025 und beleuchtet abschließend die möglichen Folgen, Probleme und Kosten einer solchen Verordnung für Firmen, Privatpersonen und Angestellte, die Wirtschaft.
Ausgangsmaterial unterer Untersuchung und Ableitung einer hypothetischen neuen 2025 tauglichen Version einer „Kriegswirtschaftsverordnung 2.0 “ bildete die Kriegswirtschaftsverordnung von 1939, amtlich verkündet im Deutschen Reichsgesetzblatt Band 1939 Teil I, Nr. 163, Seite 1609–1613, Fassung vom 4.09.1939 .
Wie wurden die Kriegswirtschaftseinkäufe und Beschaffung 1939 umgesetzt?
Die Rohstoff-Handelsgesellschaft mbH (RHG) spielte während des Dritten Reiches eine zentrale Rolle in der staatlich gelenkten Rohstoffbeschaffung. Als Monopolist koordinierte sie den Einkauf und die Verteilung kriegswichtiger Materialien wie Metalle und Öl. Der Staat unterstützte die RHG finanziell, indem er Risiken durch staatlich garantierte Wechsel oder direkte Subventionen absicherte.
Eine weitere bedeutende Organisation war die Reichswerke Hermann Göring, eine staatlich kontrollierte Industrieholding. Sie war maßgeblich in der Rohstoffbeschaffung und Rüstungsproduktion tätig und spielte eine Schlüsselrolle in der wirtschaftlichen Kriegsführung des NS-Regimes.
Diese zentralisierten Strukturen ermöglichten es dem NS-Staat, die Wirtschaft effektiv auf die Kriegsbedürfnisse auszurichten und die Versorgung der Rüstungsindustrie sicherzustellen.
Diese zentralisierten Strukturen ermöglichten es dem NS-Staat, die Wirtschaft effektiv auf die Kriegsbedürfnisse auszurichten und die Versorgung der Rüstungsindustrie sicherzustellen.
Dabei wird deutlich, dass eine moderne Kriegswirtschaftsverordnung nicht nur die wirtschaftliche und technologische Leistungsfähigkeit Deutschlands sichern müsste, sondern auch erhebliche gesellschaftliche und politische Herausforderungen mit sich bringen würde, die in aktuellen wirtschaftsglobalen Bedingungen 2024/2025: Protektionismus & Strafzölle, mit einer Verelendung der allgemeinen Bevölkerung in Deutschland einherginge mit wenigen Profiteuren.
Wir von Reiser & Partner möchten Ihnen die Chance geben sich ein eigenes Bild zu machen. Sie sollen einen umfassenden Einblick in die Funktionsweise einer historischen und hypothetischen Kriegswirtschaftsordnung bekommen, und deren weitreichende Folgen für die Sicherheit von Standorten, Unternehmen, Mitarbeitern verstehen lernen.
Der Operationsplan Deutschland ist schon da
Wir haben sie zum Glück (noch) nicht im Jahr 2025, die << Kriegswirtschaft >> doch es gibt bereits einen Eingriff in die deutsche Wirtschaft den es Jahrzehnte zuvor in Deutschland nicht gab, der << Operationsplan Deutschland >> (nennen wir ihn OPD).
Dieser OPD soll die Wirtschaft und jedes Nato und Bundeswehr kriegswichtige Unternehmen, ganz gezielt auf eine Kriegswirtschaft und Deutschland als Drehkreuz für Versorgung und Logistik (eines Feldzuges) vorbereiten. Auch wenn << Krieg>> noch nicht formal ausgesprochen wird, so sprechen doch die Taten seit Jahren für sich. Die wenigsten Menschen der heutigen Neuzeit wissen, dass die wenigsten Kriege in der Geschichte der Menschheit wirklich formal öffentlich erklärt wurden. Zumeist wurden sie einfach begonnen und die Presse und Politik kam dann schon hinterher – oder umgekehrt. Fair geht es in einem Krieg oder in der Politik nie zu. Es sei daher jedem empfohlen sich die Zeit zu nehmen – und sich selbst ein Bild zu machen und die Zeichen der Zeit zu sehen und zu akzeptieren.
Der OPD wird aktuell durch die deutsche Bundeswehr und durch die Landesoberkommandos der Bundesländer vorangetrieben. Was dort geschieht im Geheimen, wissen wir nicht, aber es dürften sich der spekulativen Logik nach um erste (vertrauliche ) Informationen (nur) für die Eigentümer der entsprechenden Unternehmen handeln. Darin dürften mehr oder weniger Transparent Zeiträume, Stückzahlen, Produktionsbedingungen, Abnahmegarantien und Zahlungsgarantien genannt oder behandelt werden, wie vielleicht ebenso die Aufforderung Patente zur Verfügung zu stellen oder Personalzahlen zu nennen die man für die Aufrechterhaltung in einem Kriegsfalle benötigen würde.
So ein Operationsplan Deutschland bedeutet für einige Unternehmen und Einrichtungen einen Gewinn, doch für die meisten der KMU die nicht kriegswichtig sind oder als diese eingeschätzt werden bedeutet das verschlechterte Bedingungen wenn es zum Kriegsfalle kommt, bis hin zur Aufgabe oder Wegzuges des Geschäftsbetriebes. Das bereits 2024 eine Kapitalflucht in Höhe ‚unterlassener Investitionen‘ (-27% USA) und tatsächlich abfließenden Geldern stattgefunden hat und zwar in Höhe von etwa 400 Mrd. Euro stattgefunden hat lässt sich nicht wegleugnen, ebensowenig wie die Zahl der Unternehmensinsolvenzen nach einer einfachen Googlesuche in der ersten vier Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um +28,3 % gestiegen ist, auch nicht. Man kann natürlich keine Zusammenhänge beweisen, aber man solle schließlich nicht vergessen, dass >> Manche eben mehr wissen und früher als Andere >> und es am Markt entsprechende Reaktionen gibt die sich auch in Zahlen ausdrücken. Die Unternehmensbörse nexxt-change.org hat nach einer aktuellen Suche am 29.05.2025 alleine für das Bundesland Banden-Württemberg mehr als 311 Verkaufsgesuche von Unternehmen und Betrieben gelistet, was zu dem Bild der veröffentlichten Insolvenzahlen gut ins Bild passt wonach alleine 2024 über 200.000 Unternehmen insolvent gegangen sind.
Operationsplan Deutschland
Doch wir Deutschen und damit auch die Unternehmen mit Sitz in Deutschland haben seit Kurzem einen << geheimen Operationsplan Deutschland >> der Bundewehr -und die Presse – landauf landab verkündet dies online über die deutsche Mainstreampresse wie unser Screenshot der Nachrichtensuche zu ‚Operationsplan Deutschland‘ in Google News transparent aufzeigt.
Google Suchergebnisse die den ‚Der Operationsplan Deutschland‘ in der Mainstreampresse zeigen.
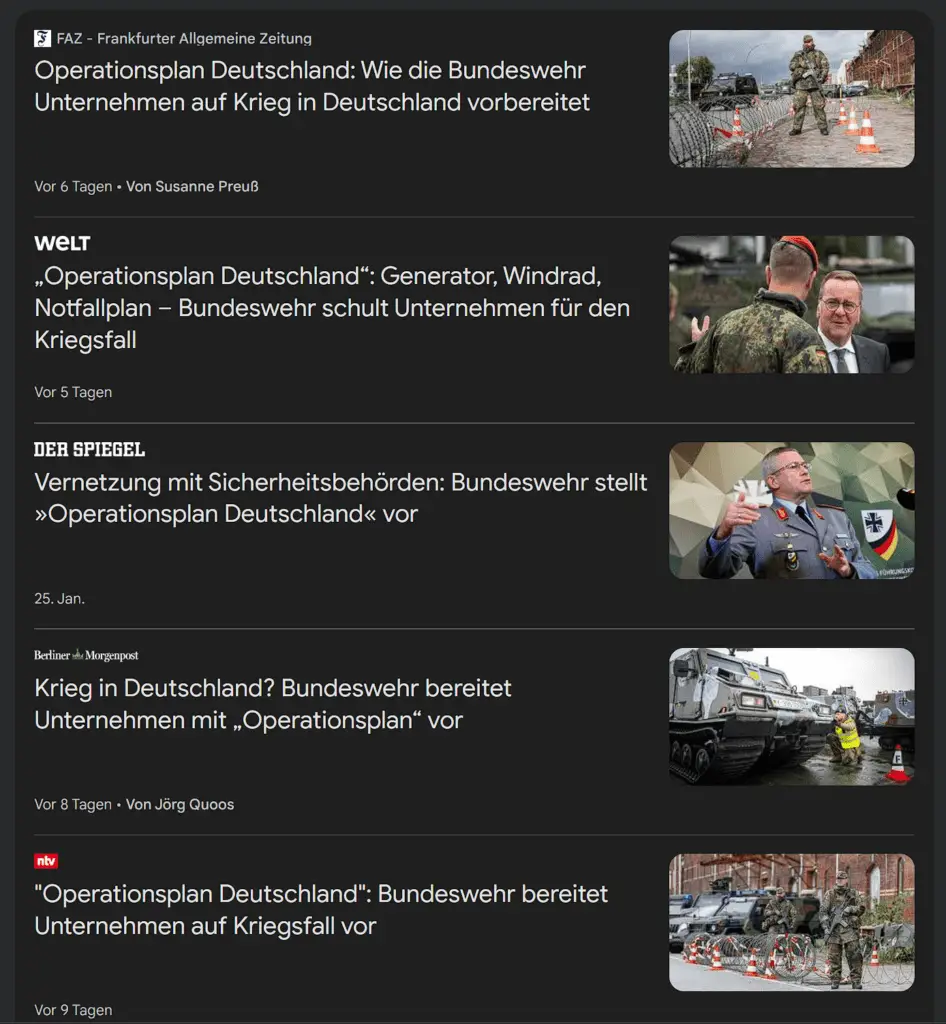
(Quelle: Google News, Suchergebnis 2024)
Die Kriegswirtschaftsverordnungen: 1939 und die hypothetische Version von 2024
Einleitung
Die Kriegswirtschaftsverordnung von 1939 wurde geschaffen, um die deutsche Wirtschaft vollständig auf die Kriegsführung auszurichten. Sie regelte dabei alle Bereiche der wirtschaftlichen Produktion, des Ressourcenverbrauchs und des gesellschaftlichen Lebens. Eine hypothetische Kriegswirtschaftsverordnung im Jahr 2024 müsste diese Prinzipien auf eine hochkomplexe, globalisierte und digitalisierte Wirtschaft anwenden. In diesem Text werden der vollständige historische Text der KWVO von 1939 präsentiert, eine moderne Fassung für 2024 entwickelt und die möglichen Folgen umfassend analysiert.
B) Hypothetische Kriegswirtschaftsverordnung 2025
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Kriegswirtschaftsverordnung nicht existiert und nur als informatives hypothetisches Verdeutlichungsmaterial zu werten ist. Dennoch sind die darin enthaltenen Maßnahmen grundsätzlich denkbar und möglich.
Präambel
Abschnitt I: Technologisches Verhalten
§ 1
(Anpassung: IT, Cloud-Konzepte, …)
Abschnitt I: Digitales Verhalten
§ 1 – Verpflichtung zur Bereitstellung von Technologien
- Unternehmen aus den Bereichen IT, KI, Cybersicherheit, Robotik und Biotechnologie werden verpflichtet, alle Technologien, die strategisch relevant sind, staatlich zur Verfügung zu stellen.
- Patente und geistiges Eigentum können zeitweise vom Staat genutzt werden, um kritische Produktion und Verteidigung sicherzustellen.
§ 2 – Überwachung und Kontrolle digitaler Infrastruktur
- Cloud-Services, Server-Infrastrukturen und Netzwerke von Unternehmen unterliegen staatlicher Kontrolle, um Angriffe oder Missbrauch zu verhindern.
- Unternehmen müssen ihre digitalen Kapazitäten priorisiert für staatliche Aufträge bereitstellen.
§ 3 – Schutz der digitalen Bevölkerung
- Digitale Bürgerdaten können zur Vermeidung von Cyberangriffen und Desinformationen analysiert werden, sofern dies zur nationalen Sicherheit notwendig ist.
Abschnitt II: Ressourcenlenkung
§ 4 – Verpflichtende Produktion für kriegswichtige Zwecke
- Unternehmen in der Industrie (z. B. Automobil-, Chemie- und Maschinenbau) müssen mindestens 70 % ihrer Kapazitäten für kriegsrelevante Produktion bereitstellen.
- Nicht kriegsrelevante Produktionen können durch staatliche Verfügung vorübergehend eingestellt werden.
§ 5 – Zentralisierte Rohstoffzuteilung
- Rohstoffimporte werden durch den Staat zentral verwaltet und priorisiert auf Branchen mit strategischer Bedeutung verteilt.
§ 6 – Nachhaltige Ressourcennutzung
- Unternehmen werden verpflichtet, Rohstoffe effizient und nachhaltig zu nutzen. Recycling von Metallen, seltenen Erden und Kunststoffen wird staatlich kontrolliert.
Abschnitt III: Arbeitskräftemobilisierung
§ 7 – Fachkräftepriorisierung
- Personen aus kritischen Branchen (IT, Ingenieurwesen, Medizin, Logistik) können verpflichtet werden, für nationale Sicherheitszwecke zu arbeiten.
§ 8 – Arbeitszeiten und Urlaubsregelungen
- Die reguläre Arbeitszeit wird auf bis zu 48 Stunden pro Woche angehoben, Urlaubsansprüche können ausgesetzt werden.
§ 9 – Umverteilung von Arbeitskräften
- Unternehmen müssen Arbeitskräfte in weniger relevanten Bereichen für staatlich priorisierte Projekte freistellen.
Abschnitt IV: Finanzierung und Kriegssteuern
§ 10 – Einführung einer Sondersteuer
- Einkommen oberhalb von 60.000 EUR pro Jahr unterliegen einem zusätzlichen Kriegszuschlag von 20 %.
- Gewinne über 10 Millionen EUR jährlich werden mit einer Abgabe von 25 % belegt.
§ 11 – Verbrauchssteuern auf fossile Energien und Luxusgüter
- Verbrauchssteuern auf Kraftstoffe, Alkohol, Tabakwaren und Luxuswaren werden um 50 % erhöht.
Abschnitt V: Klimaneutrale Kriegswirtschaft
§ 12 – Nachhaltigkeit in der Produktion
- Alle Produktionsstätten müssen bis 2025 auf nachhaltige Energiequellen umgestellt sein.
- Unternehmen, die CO₂-neutral produzieren, können von Steuererleichterungen profitieren.
§ 13 – Recycling und Wiederverwertung
- Kriegsbedingte Produktionsabfälle müssen verpflichtend recycelt werden.
- Unternehmen können staatlich gefördert werden, wenn sie Kreislaufwirtschaftskonzepte umsetzen.
C) Folgen, Probleme und Kosten der KWVO 2024
1. Auswirkungen auf Unternehmen:
- Kosten: Hohe Investitionen für Produktionsanpassungen und Digitalisierung. Es ist fraglich ob heute 2025, selbst unter Zuhilfenahme von AI in einem historisch gewachsenen Produktions- und Industrieumfeld die digitalen Anpassungen alleine schon – umsetzbar sind. Manche Großunternehmen scheitern bei der technischen Konsolidierung von 150 auf 40 Großrechensysteme. Weshalb dann kein scheitern bei einem ganzen Land mit verzweigten Vernetzungen, Rechenzentren, customized Applikationen stattfinden – und Umstellungen dann reibungslos verlaufen sollen, ist nicht ganz stimmig.
- Probleme: Verlust von ziviler Innovationsfähigkeit, Bürokratisierung.Denn obwohl zwar stets der militärische Bedarf eine Vorreiterrolle auch für zivile Produkte im nachhinein eine Rolle spielte, ist es doch so anzunehmen, dass diese Innovationen erst sehr spät und zeitverzögert Einzug in den Zivilbereich halten werden. Kriegswichtigkeit verzögert aus Geheimhaltungsgründen.
- Chancen: Stärkung der Position in Schlüsselindustrien wie IT, erneuerbare Energien und Cybersecurity.
2. Auswirkungen auf Bürger:
- Kosten: Erhöhte Steuerlast, Einschränkungen in der Arbeitsmobilität und Freizeitgestaltung.
- Probleme: Widerstand durch Eingriffe in Datenschutz und Konsumfreiheit.
3. Auswirkungen auf den Staat:
- Kosten: Hohe Verwaltungsaufwände, potenzielle Verschuldung durch Subventionen.
- Probleme: Komplexität der Umsetzung in einer globalisierten Wirtschaft.
4. Internationale Konsequenzen:
- Kosten: Handelskonflikte durch Export- und Importbeschränkungen.
- Probleme: Spannungen mit globalen Partnern, insbesondere in Lieferkettenabhängigen Industrien.